Erstes Feedback

Charlotte Theile entdeckt in N°1 «Interviews, Reportagen und Essays, die erzählen, was Sport mit einem Körper, einer Familie, einer Nation anstellen kann». Sie glaubt, «der Ziegelstein» werde bald «in vielen Regalen zu finden sein».
Dem wollen wir nicht widersprechen.
Endlich: N°1 ist da

Liebe Leserinnen und Leser: Dieses Jahr feiern wir Weihnachten bereits am 3. Dezember, denn heute erscheint endlich N°1.
Die im Crowdfunding erworbenen Exemplare wurden soeben ausgeliefert, bei euch im Briefkasten ist N°1 morgen, übermorgen oder spätestens Ende der Woche (warnt eure Briefträger, das Heft ist ein Monster!).
Wir sind nervöser als Arjen Robben vor dem Penalty – lasst uns wissen, ob und wie es euch gefällt!
Euer N°1-Team
Die N°1-Leseempfehlungen
Der helle Wahnsinn: «The Curious Case of Sidd Finch»
Von Mikael Krogerus – Die meisten Hobbysportlerinnen und Hobbysportler hatten als Kinder eines gemeinsam: Den Traum, so gut zu werden wie ihr Idol. In meinem Fall malte ich mir tausendfach aus, dass ich eines morgens erwache, ein leichtes Ziehen in den Beinen verspüre und plötzlich Eishockey spielen kann wie Saku Koivu. Tatsächlich konnte ich nicht mal richtig Schlittschuhlaufen, Kleinkinder überholten mich auf dem Eis. Es blieb also ein Traum – aber der Traum blieb auch! Bis heute kommt es vor, dass ich im Bett liege und mir einbilde, eine ausgefeilte Yoga-Technik könnte eine Art verborgene Energiequelle freilegen, dank der ich mich auf Schlittschuhen flinker als in Laufschuhen bewege, ein Scout der Colorado Avalanches wird auf mich aufmerksam, und im siebten Spiel des Stanley-Cup-Finals gibt mir der Coach das Signal…
Ein solcher Traum – den wohl die meisten Sportfans, wenn sie ehrlich sind, so oder ähnlich kennen – ist der Ausgangspunkt einer der irrsten und zugleich schönsten Sportreportagen: «The Curious Case of Sidd Finch», geschrieben von George Plimpton, erschienen 1985 in «Sports Illustrated».
Worum geht es? Plimpton berichtet von einem neuen Pitcher, den die New York Mets unter Vertrag genommen haben, einem gewissen Sidd Finch. Finch ist ein Buddhist, der nach Jahren des mönchischen Lebens und dank einer in Tibet erlernten Meditationstechnik imstande ist, einen Baseball mit 270 km/h zu werfen (niemand warf je schneller als 160 km/h).
Der Aprilscherz funktionierte über Erwarten: Zeitungen im ganzen Land berichteten über den jungen, medienscheuen Buddhisten, ohne ihn je zu Gesicht bekommen zu haben, Reporter und Fans belagerten das Trainingslager der Mets. Für einen wunderbaren Moment glaubte selbst das Management des Teams, es hätte den Ballkünstler unter Vertrag. Irgendwann flog der Spass natürlich auf, und es gab ein Riesengeschrei, Leser kündigten zu Hunderten ihre Abos, die journalistischen Standards von «Sports Illustrated» wurden ernsthaft hinterfragt. Es war ein Shitstorm avant la lettre. Aber viele Leserinnen und Leser, auch ich, fühlten sich bei der Lektüre auf einer fast schon spirituellen Ebene angesprochen. Denn Plimptons Text war mehr als eine brillant geschriebene Persiflage auf die innere Logik einer nach neuen Superstars gierende Sportszene. Der Text handelt von der grossen Frage, ob wir nicht auch ganz anders sein könnten, wenn wir nur unsere eigenen Begrenzungen überwinden würden, unser Yoga-Programm besser durchziehen, unsere Leben ändern, unseren Horizont erweitern – und ob wir das eigentlich wirklich wollen.
So viel Nachdenklichkeit, so leicht erzählt. In einem Sportheft. Es ist der Wahnsinn, wirklich. Aber lesen Sie selbst.
Hier der Text.
Das Ende einer Projektion: «Wo Ronaldinho ist, ist immer der Strand»
Von Benjamin Steffen – Es gibt dieses Foto auf der letzten Seite dieses Texts (öffnen Sie deshalb auch den Link mit dem PDF!), wie ein Teenager in seinem Bett sitzt, die Arme in die Höhe gestreckt, nackter Oberkörper, 19 Jahre alt, im Nachttisch kauert ein hellblauer Teddybär, wir schreiben das Jahr 1999, es ist der Teddybär von Ronaldo de Assis Moreira, kurz Ronaldinho, der später zum besten Fussballer der Welt werden sollte. 2004 und 2005 gewann Ronaldinho diese Auszeichnung, und vor der Fussball-WM 2006 unternahm der «Spiegel»-Reporter Dirk Kurbjuweit den Versuch, Ronaldinho noch einmal zu treffen, so wie 1999, als er Ronaldinho ein erstes Mal besucht hatte, weil es hiess, Ronaldinho werde der Fussballer des 21. Jahrhunderts.
Deshalb mag ich diese Reportage – weil sie ein Versuch ist; und ein Zeitzeugnis dafür, dass es Ende des letzten Jahrtausends noch möglich war, Fussballstars der Zukunft an ihrem Ursprung zu besuchen; und erst eine Andeutung, welche Auswüchse das Fussball-Business dereinst noch erfahren würde. Es war eine letzte Gelegenheit, guten Gewissens eine solche Eloge über diesen Fussballer zu schreiben, denn es kam die WM 2006, Brasilien schied im Viertelfinal aus, Ronaldinho spielte vier Mal und schoss kein Tor, es war womöglich der Anfang des Abstiegs. Ronaldinho wurde nicht zum Fussballer des 21. Jahrhunderts, offenbar hatte niemand geahnt, dass noch Lionel Messi und Cristiano Ronaldo kommen würden, besser als Neymar, der vielleicht transferiert wird für so viel Geld wie noch kein Fussballer des 21. Jahrhunderts, aber Ronaldinho gewiss nicht überflügelt.
Und ich mag diese Reportage dieses wunderbar langen Satzes wegen, 167 Wörter, ein Satz, der viel länger ist, als heute ein Tweet sein darf, aber er sagt nicht weniger aus, beileibe nicht, er sagt zum Beispiel ganz viel aus über das Scheitern von Journalisten, dass man immer wieder anrennt, immer wieder Mut fasst, immer wieder versagt; dass man immer wieder glaubt, was man suche, tauche wahrhaft auf, ein Mensch oder ein guter Satz – aber nein, es sind immer nur Bilder und Vorstellungen. Der Satz lässt kaum Zeit durchzuatmen, aber wenn wir uns festhalten, wirft er uns nicht aus der Bahn, er lautet: «Er (ein Fotograf, der dem Journalisten helfen will, Ronaldinho zu treffen) winkt, er rast los, um das Stadion herum, ins Stadion hinein, drückt einem unterwegs einen Blackberry in die Hand, der seine Fotos von Ronaldinho zeigt, er verhandelt mit Wachmännern, führt durch Lounges im Stadion, der Palm zeigt automatisch Bild um Bild, Ronaldinho beim Schuss, Ronaldinho beim Dribbling, Claudio rast eine Treppe hinunter, öffnet eine Tür, Ronaldinho mit Anzug und Krawatte, hinter der Tür ist die Tiefgarage mit den Autos der Spieler, Cayennes, Hummers, Touaregs, Ronaldinho mit Maradona, Claudio stoppt bei einem Familienvan von Seat, in dem ein schläfriger Junge sitzt, Ronaldinho mit seinen Trophäen, der Junge ist Thiago, der Fahrer und Freund von Ronaldinho, und jetzt guckt er sich die Zeitschrift von ’99 an und das Foto von Ronaldinho im Bett, und in seinem Gesicht regt sich nichts, er sagt nichts, nur Claudio redet ununterbrochen, Ronaldinho beim Schuss, beim Dribbling, im Anzug, und Claudio redet, und dann macht der Junge die Surferbewegung mit der Hand, und Claudio macht sie auch und geht und sagt nichts mehr.»
Ich mag diese Reportage, weil sie sich einem Menschen nähert – und als der Reporter Ronaldinho so nahe kommt, wie er einen Satz, eine Woche oder vielleicht sechs Jahre lang gehofft hatte, merkt er, dass zu viel Nähe bloss die geliebte Projektion zerstört. Es heisst: «Ein Gespräch mit einem Fussballspieler wie Ronaldinho hat seine Grenzen. All das, was man sich ausdenkt, was man empfindet über die Schönheit, die Magie, die Bedeutung, das spiegelt sich nicht in solchen Gesprächen, das spielt sich nur im eigenen Kopf ab, in der eigenen Seele.» So ist es – aber vielleicht nicht nur in Gesprächen mit Fussballerspielern, mit den Allerbesten und den weniger Guten, sondern ganz generell. Deshalb mag ich diese Reportage.
Und nun, gerade dieser Tage, als zu lesen war, Ronaldinho engagiere sich in Brasilien für eine ziemlich rechts gelagerte Partei, als es leicht war, Empörung zu empfinden, obwohl sein Bruder die Meldung dementierte – da merkte ich wieder, warum ich diese Reportage erst recht mag: weil man Ronaldinho nicht zu mögen lernt. Aber auch nicht, ihn nicht zu mögen.
Hier der Text. Und hier das PDF des Textes. Die Sonderausgabe «Planet Fussball» des Nachrichtenmagazins «Spiegel» erschien vor der WM 2006 in Deutschland, als die Welt zu Gast bei Freunden war. Das Magazin enthält Reportagen und Texte aus der ganzen Welt, teilweise mit erstaunlich langer Gültigkeit. Bei der Analyse über die Schweizer Fussballer hiess es: «Rund 30 Nachwuchsspieler unter 19 Jahren stehen derzeit bei ausländischen Vereinen unter Vertrag. So wundert es kaum, dass man sich in der Schweiz grosse Hoffnungen macht.»
Aus dem Leben eines Boxers: «Brownsville Bum»
Von Christof Gertsch – Es gibt eine Sportgeschichte, die ich so oft schon hervorgeholt habe, dass ich sie auswendig erzählen könnte, Wort für Wort, Satz für Satz – und doch entdecke ich bei jedem Lesen neue Feinheiten, neue Genialitäten, neue Abschnitte, in die ich mich verliebe. Die Geschichte stammt von W. C. Heinz, einem der aufregendsten Autoren von Sporttexten des letzten Jahrhunderts, und handelt von Bummy Davis, einem Boxer aus Brooklyn, den die Leute erst zu mögen begannen, als er schon gestorben war.
Gewiss – von allen Sportdisziplinen ist Boxen wahrscheinlich das dankbarste Objekt für Journalisten. Das liegt daran, dass das, was im Viereck des Rings geschieht, so verständlich und so einfach aufs Leben übertragbar ist. Zwei Menschen stehen sich gegenüber, und nur einer kann gewinnen. Dass Menschen, die im Boxen gut sind, es im Leben meistens nicht so sind, macht die Affiche für Schreiberlinge nur noch attraktiver. Es gibt auch tatsächlich viele ausgezeichnete Boxreportagen, vielleicht so viele wie von keiner anderen Sportart, aber das macht die von W. C. Heinz nicht weniger einzigartig. Im Gegenteil.
Der Einstieg in den Text geht so: «Die Menschen sind schon komisch. Da hassen sie einen Kerl sein Leben lang für das, was er ist, aber sobald er dafür stirbt, machen sie einen Helden aus ihm und erzählen der ganzen Welt, dass er wohl doch kein so schlechter Kerl war, da er ja bereit gewesen sei, für das, woran er glaubte oder was er war, bis zum Äussersten zu gehen.»
Die Geschichte von Bummy Davis ist die eines irgendwie bemitleidenswerten Kämpfers, der zu wenig lang zur Schule gegangen war, als dass er genügend Wörter zur Verfügung gehabt hätte, um angepasst auf Pöbeleien oder auch nur Beleidigungen zu reagieren. Seine Antwort war immer dieselbe: sein linker Haken. Das ging lange gut, aber als ihn vier Möchtegernbanditen eines Abends in Dudy’s Bar – einem Pub, das er eine Zeitlang besessen hatte – blöd anmachten, lief es aus dem Ruder. Den ersten Gauner vermöbelte Bummy Davis noch. Beim zweiten war er tot. Denn der trug einen Revolver bei sich und setzte ihn dummerweise ohne zu zögern ein.
Das ist die Ausgangslage des Textes von W. C. Heinz: Der Tod von einem, der bis tief nach Manhattan hinein allen bekannt war – aber eben nur für seine etwas einfältige Boxkunst. Am 22. November 1945 prangte die Meldung seines Hinschieds auf der Frontseite der «New York Times», erst 1951 erschien das Zwanzigseitenwerk von W. C. Heinz. Was doch zeigt: Es kann noch so viel Zeit zwischen dem Geschehen und der Erzählung liegen – wenn die Geschichte gut ist, bleibt sie es. Nicht nur sechs, sondern auch sechzig Jahre später.
Kurz zum Autor: W. C. Heinz hat in seinem langen Journalistenleben über alles Mögliche geschrieben, er war Kriegskorrespondent, Lokalreporter und Autor von Kurzgeschichten, aber am meisten zugetan war er dem Sport. Schon als Student hatte er die Sportseiten der Schulzeitung verantwortet, ab 1948 schrieb er für die «New York Sun» eine tägliche Sportkolumne. Dort verfasste er auch den Text, für den er fast noch bekannter ist als für «Brownsville Bum»: «Death of a Racehorse». Darin schildert er die letzten Augenblicke im Leben eines Pferdes, das sich auf der Rennbahn verletzt und vom Arzt den Gnadenschuss erhält. Der Text ist schon für sich genommen ein Meisterstück – aber wenn man noch weiss, dass W. C. Heinz drei Stunden bis Druckbeginn blieben, um ihn herunterzuschreiben, kommt man aus dem Staunen kaum noch heraus.
Zurück zu Bummy Davis. Oder aber: So viel gibt es dazu gar nicht mehr zu sagen. Besser, Sie lesen den Text einfach. Nur dies noch: Der Text beweist, dass die besten Geschichten immer noch das Leben selbst schreibt. Trotzdem ertappe ich mich jedes Mal, wenn ich ihn hervornehme, dabei, wie ich denke: Wäre mir völlig egal, wenn die Erzählung frei erfunden wäre, so gut ist sie. Geschrieben mit einer Leichtigkeit und einer Durchdringlichkeit, dass man sich in einem Buch von Ernest Hemingway wähnt (wirklich wahr!).
Hier der Text im Original. Eine deutsche Übersetzung kann im soeben erschienenen und sehr empfehlenswerten Sammelband «Die stille Saison eines Helden», herausgegeben von Dominik Fehrmann, nachgelesen werden – dort unter dem Titel «Der linke Haken von Brownsville». Und hier der Link zu «Death of a Racehorse».
Das Grosse im Kleinen: «The Thunder and the Hurricane»
Von Bänz Friedli – «They’re trying to wash us away», lautet eine Zeile in Randy Newmans Lied über die Flutkatastrophe im US-Südstaat Louisiana im Jahr 1927. Wer je gehört hat, wie Zehntausende diesen Refrain am jährlichen Jazz and Heritage Festival auf der Pferderennbahn von New Orleans wie aus einer Kehle singen, dem geht der Song fortan durch Mark und Bein: Hier fühlt sich die Bevölkerung einer ganzen Region von ihrer Regierung vernachlässigt, vom offiziellen Amerika vergessen, ja dem Untergang preisgegeben: «They’re trying to wash us away».
Die Liedzeile erhielt mit der Überflutung der Stadt nach dem Wirbelsturm «Katrina» 2005 bittere Aktualität. Nur wer ein Auto besass, konnte sich retten; über 1800 Menschen starben, und die vermeintliche Natur- erwies sich am Ende als politische Katastrophe: New Orleans’ Deiche barsten, weil das Bundesbudget für Unterhaltsarbeiten gekürzt worden war, um George W. Bushs irrwitzigen Irakfeldzug zu finanzieren. «They’re trying to wash us away».
Hier setzt die Schriftstellerin Pia Z. Ehrhardt mit der Geschichte «The Thunder and the Hurricane» an, die sie 2016 im «Oxford American» publizierte, einer Zeitschrift über die Kultur und Gesellschaft des US-Südens. Auf wenigen Seiten erzählt die Autorin, die noch immer in New Orleans lebt, von Fussballjunioren in der flutversehrten Stadt; davon, wie die Mitglieder eines Teams durch «Katrina» in alle Himmelsrichtungen versprengt wurden; wie sie allmählich wieder zusammenfanden und wie das gemeinsame Ringen ihnen half, über das Geschehene hinwegzukommen. Autorin Ehrhardt war die Mutter eines der Spieler, und dessen Team hatte im Jahr zuvor in seiner Altersklasse die Meisterschaft des Gliedstaats Louisiana errungen.
Aber in der Erzählung geht es um weit mehr als sportlichen Erfolg. Es geht um Freundschaft, Verlässlichkeit, Solidarität, darum, wie unterschiedliche Charaktere ein Team formen und wie das Team Einzelnen helfen kann, traumatisierende Geschehnisse zu überwinden. Aber nicht allen: «The Thunder and the Hurricane» hat nicht einfach ein Happy End, denn es erzählt aus dem richtigen Leben.
Über «Katrina» hatte ich viel gelesen, nie aber war es jemandem gelungen wie nun Ehrhardt, die Naturkatastrophe, die zum gesellschaftlichen Desaster geriet, so persönlich zu erzählen. Anhand einer kleinen Episode, die auf die grossen Zusammenhänge verweist und aufzeigt, was die schrecklichen Vorgänge von 2005 für die einzelnen Menschen bedeuteten. War das nun Literatur oder Journalismus? Beides. Berührend und doch erbarmungslos präzise.
Das kleine Lesestück, von dem ich so Feuer und Flamme war, dass ich die Lektüre über die Abende einer ganzen Woche künstlich in die Länge zog, ist eine mustergültige Erzählung, weil es das Unfassbare, Immense, Unbegreifliche konsequent an einer kleinen Gruppe Menschen exemplifiziert, es also das Grosse im Kleinen schildert. Gleichzeitig ist es mein liebstes sportjournalistisches Werk, weil es zwar von mehr oder weniger Namenlosen handelt, aber aufzeigt, wie ein Team sich nicht einfach hinwegspülen lässt. «They’re trying to wash us away» – aber es gelang nicht. Eine Geschichte darüber, was Sport fernab der Scheinwerfer vermag.
Hier der Text. Der «Oxford American» ist ein hervorragend gemachtes, viermal jährlich erscheinendes Magazin mit künstlerischen Fotografien sowie literarischen und journalistischen Texten über den US-Süden, in denen es um Essen, Musik, Gesellschaft, Politik und zwangsläufig auch immer wieder um Rassismus geht. Abonnemente und Geschenkabos gibt’s hier.
Ein Welt-Drama namens Fussball: «Football against the Enemy»
Von Bruno Ziauddin – Mein Lieblingstext ist ein Buch.
Im Frühjahr 2006 bin ich für eine Reportage über den iranischen Fussball nach Teheran gereist. Ein paar Monate zuvor hatte sich die Nationalmannschaft für die WM qualifiziert. Mein Fremdenführer war ein junger, sehr intelligenter, aber ziemlich depressiver Sportjournalist. Auf der Fahrt zum Lokalderby (Persepolis gegen Esteghlal, 110’000 Zuschauer) fing er unvermittelt an zu strahlen – zum ersten und letzten Mal während unserer gemeinsamen Zeit. Und alles nur, weil ich beiläufig erwähnt hatte, dass ich den Autor des Buches, über das wir uns gerade unterhielten, persönlich kannte. «Was, du bist mit Mister Simon Kuper befreundet?», stammelte der traurige Iraner ergriffen. «Bitte richte Mister Kuper aus, dass ich, wie auch sämtliche meiner Kollegen, grösste Hochachtung für ihn empfinden!»
Da wurde mir so richtig bewusst, was ich schon ahnte: Unter Sport- oder zumindest Fussballjournalisten ist Simon Kuper ein Star. Ein Weltstar. Das hat nur in zweiter Linie mit seinen Kolumnen in der «Financial Times» zu tun, so witzig, luzid, ja brillant sie sein mögen. Ausgezeichnete Sportkolumnisten gibt es noch ein paar andere. Aber keiner hat so ein Buch geschrieben wie Kuper (mit gerade mal 25 Jahren, übrigens). Das Buch ist 1994 erschienen, heisst «Football against the enemy» und ist in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt worden, 2009 in einer aktualisierten Version auch ins Deutsche.
Im Prinzip handelt es sich um eine Grossreportage in 21 Kapiteln, für die der Autor während neun Monaten fast zwei Dutzend Länder bereist hat. Die Geschichten, die Kuper erzählt, liegen fernab von Matchberichten, Resultathuberei oder dem in jüngster Zeit unter Sportbloggern besonders populären Taktikgeschwurbel. Es sind lehreiche, groteske, berührende, derbe, todernste und heitere Geschichten, die den Fussball als Welt-Drama begreifen und dadurch auch viel über die real existierende Welt aussagen – über menschliche Grösse und Niedertracht, über Ängste und Hoffnungen, historische Rivalitäten und nationale Schrulligkeiten. Über den holländischen Libero (so was gab es damals) Ronald Koeman, der nach dem gewonnenen EM-Halbfinale ein deutsches Trikot als Toilettenpapier benutzte, über die Millionenkredite der argentinischen Militärjunta an Peru kurz vor einem entscheidenden WM-Spiel (Argentinien gewann 6:0), über die Bedeutung von Muti, schwarze Magie im afrikanischen Fussball oder über den Arsenal-Fan Osama bin Laden.
Simon Kuper lesen heisst Fussball verstehen.
Die deutsche Fassung von Simon Kupers Buch ist vergriffen, die englische ist als Kindle Edition erhältlich.
Sechs Wahrheiten

Alle bisher erschienen Beiträge
Wahrheit No. 1: Materialschlacht
Wahrheit No. 2: Futtertrieb
Wahrheit No. 3: Selfie-Stress
Wahrheit No. 4: Verkehrssünden
Wahrheit No. 5: Dopingprobleme
Ein Tag im Leben
 Timea Bacsinszky
Timea Bacsinszky
Alle bisher erschienen Beiträge
Der Tag nach EM-Gold: Viktor Röthlin
Ein Tag an der Schule: Andri Ragettli
Zwei Wochen im Senegal: Mujinga Kambundji
Monate des Verletztseins: Timea Bacsinszky
Ein Tag an der ETH: Dominique Gisin
Der Sport-Podcast
Alle bisher erschienen Beiträge
Über YB, Arschlöcher im Fussball, Muhammad Ali und Celtic Glasgows 18-jähriger Aussenverteidiger: Mikael Krogerus spricht mit Pedro Lenz
Über die NFL, Bill Belichick, den Post-Quaterback-Diskurs, moderne Sklaven, degenerative Hirnerkrankungen und die Kansas City Chiefs: Mikael Krogerus spricht mit Philippe Wampfler
Über die hohe Kunst, Federers Spiel zu lesen, «Peak Nadal», Djokovics fehlende Authentizität und den Unterschied zwischen kommentieren und moderieren: Mikael Krogerus spricht mit Stefan Bürer
Über Köbi Kuhn und die «Schande von Istanbul»: Mikael Krogerus spricht mit Beni Huggel
Über ihre Rolle als Captain, über die Vorzüge des Frauenfussballs (spektakulärer und frei von Homophobie), über Heimatgefühle und über die Frage, ob sie für mehr Geld streiken würde: Bänz Friedli spricht mit Lara Dickenmann
Plan B
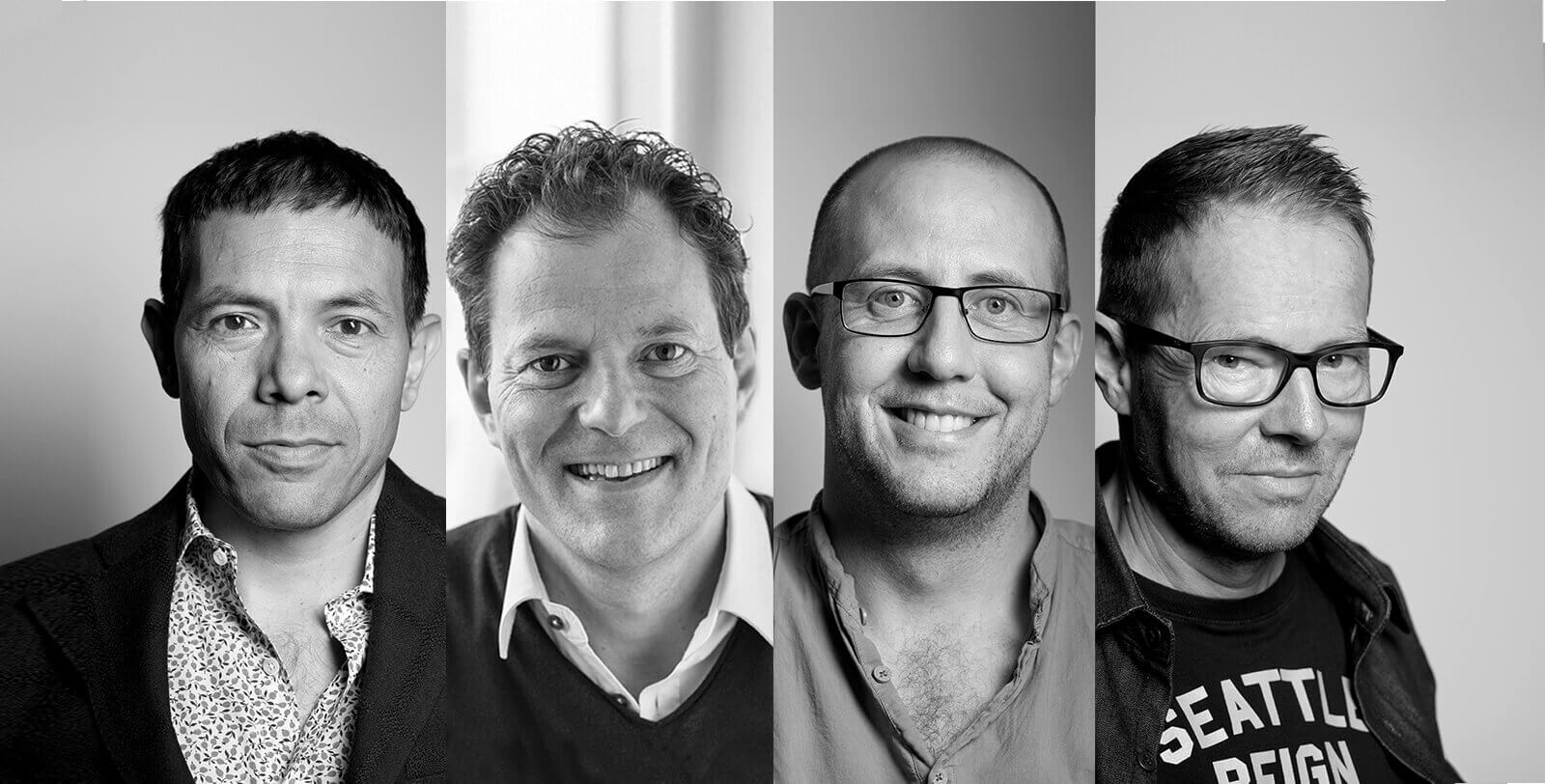 Von links: Bruno Ziauddin, Benno Maggi, Benjamin Steffen, Bänz Friedli.
Von links: Bruno Ziauddin, Benno Maggi, Benjamin Steffen, Bänz Friedli.
Alle bisher erschienen Beiträge
Bruno Ziauddin: Eine Biographie in zwölf WM-Endrunden
Benno Maggi: Defense first
Bänz Friedli: Erinnerung an den Sommerschnee
Gastautor Simon Kuper: Europa vs. Rest der Welt 8:1
Benjamin Steffen: Die Schönheit des Spiels, der Lauf des Lebens
Bruno Ziauddin: Doppelbürger
Ein Tag im Leben

Dominique Gisin: Jazz-Dance, Astrophysik, Müesli
Mein Tag sieht heute ganz anders aus als damals, als ich noch Sportlerin war. Aber eins ist geblieben: Die Nacht hat für mich eine reinigende Wirkung. Als Skifahrerin kämpfte ich manchmal einen ganzen Tag lang mit einem technischen Problem, und erst als ich darüber geschlafen hatte, konnte der Körper es lösen und richtig umsetzen. Auch heute wache ich meistens sehr früh auf, manchmal bin ich schon um 5.30 Uhr aus dem Bett. Meine Gedanken wecken mich – etwa ein Experimentbericht oder eine Übungsserie, die ich für das Physikstudium fertig stellen muss. Mir kommt dann in den Sinn, dass ich eine Aufgabe falsch gelöst habe, und ich kann nicht anders, als aufzustehen und sie zu korrigieren. Das ist oft das Erste, was ich mache: Ich sitze im Pyjama am Pult und grüble an einer Aufgabe.
Danach trinke ich einen Kaffee, frühstücke und fahre mit dem Velo zur ETH. Zwei bis drei Mal die Woche gehe ich dort morgens zum Sport, damit ich nicht völlig einroste. Ich mache Jazz-Dance oder Yoga, rudere oder gehe mit einer Freundin ins Gym. Ich trainiere nie alleine, und ich folge keinem Trainingsplan. Ich mache Sport, weil es mir Spass macht und weil ich nicht den ganzen Tag vor meinen Aufgaben oder dem Computer sitzen will. Gleich nach dem Rücktritt hatte ich ziemlich Mühe: Mein Körper war sich nicht gewohnt, so viel zu sitzen, und ich bekam Rückenschmerzen.
Der Sport hat mir auch geholfen, an der ETH Leute kennenzulernen. Am Anfang war das nicht so einfach, viele hatten Respekt vor mir und getrauten sich nicht, mit mir zu reden. Das fand ich zwar herzig, aber irgendwann fragte ich mich, ob mit mir etwas nicht stimmt, weil ich nicht sofort Anschluss fand. Aber ich bin halt eine Exotin: Ich bin mit Abstand die Älteste in meinem Studiengang, und dann war ich auch noch Skifahrerin.
Mittlerweile frühstücke ich nach dem Sport aber oft mit Kolleginnen und Kollegen an der ETH. Dann stehen Vorlesungen in Fächern wie Festkörperphysik, Astrophysik und Elektrodynamik auf dem Programm. Festkörperphysik gefällt mir besonders gut, das ist ziemlich straightforward. Wir untersuchen die Struktur von festen Stoffen und fragen: Warum passiert etwas? Warum ist ein Stoff elektrisch geladen oder magnetisch, warum ist er ein Metall und kein Isolator? Ich finde es spannend, den Sachen auf den Grund zu gehen.
Ich bin nun im fünften Semester, deshalb habe ich nicht mehr ganz so viele Vorlesungen – und mir bleibt Zeit für anderes. Ich habe einen Assistenzjob an der ETH, nachmittags leite ich eine Übungsstunde für Maschinenbaustudent_innen der unteren Semester. Das mache ich auch, weil ich selber am meisten lerne, wenn ich anderen etwas beibringe.
Nach dem Olympiasieg erhielt ich viele Anfragen von Firmen, die wollten, dass ich einen Vortrag über meine Erfahrungen als Spitzensportlerin halte. Ich sollte erzählen, wie ich mich immer wieder aufgerafft habe, trotz all den Verletzungen und Rückschlägen. Mittlerweile mache ich das regelmässig: Ich fahre nach der ETH zu Firmen und halte zusammen mit meinem ehemaligen Mentalcoach ein Motivationsreferat. Es soll den Leuten etwas für ihren Alltag mitgeben, auch wenn sie nichts mit Spitzensport zu tun haben.
Jetzt, wenn die Wettkampfsaison beginnt, vermisse ich das Skifahren am meisten. Ich sehe auf Instagram, dass meine ehemaligen Kolleginnen und Kollegen auf der Piste sind, und es kribbelt in mir. Aber ich weiss, dass diese Kapitel für mich zu Ende ist: Für mich gibt es ja keine Rennen mehr.
Dieses Gefühl wird immer schwächer, es ist schon weniger stark als noch vor einem oder zwei Jahren. In diesem Semester hat es mich aber auch erstmals so richtig gepackt an der ETH. Erst jetzt lerne ich mit derselben Motivation, mit der ich früher das Training absolviert habe.
Am Abend esse ich in meiner kleinen Wohnung Znacht, meistens nicht viel, nur ein Müesli oder so. Dann schaue ich, wie viel Energie ich noch habe. Wenn sie stimmt, löse ich Physikübungen – manchmal bis in die Nacht hinein.
Protokoll: Ursina Haller
Wahrheit No. 5: Dopingprobleme

Ursina Haller – Als es klingelte, lag ich noch im Bett. In Unterhose und T-Shirt rannte ich zur Tür und drückte den Knopf der Freisprechanlage. Dann hörte ich draussen im Treppenhaus jemanden sagen: «Hallo? Wir sind hier oben!»
Wir? Wer wagt einen Gruppenbesuch an einem Freitagmorgen kurz nach 6? Ich spähte durch das Guckloch. Und da sah ich sie stehen: Zwei Frauen, ein Mann, mit Seitentaschen über den Schultern und Formularen in der Hand.
Mir wurde beinahe schwarz vor den Augen. Nicht einmal zwei Stunden waren vergangen, seit ich selber durch diese Tür gegangen war. Mein Hirn bastelte undeutliche Bilder zusammen: Ich im Training. Später auf dem roten Teppich der Swiss Snowboard Awards. Ich mit einem Prosecco in der Hand und auf der Tanzfläche. Ich noch später auf dem Heimweg, platt wie ein Brötchen.
Dass nun, nur kurz nach diesen Ereignissen, Dopingkontrolleur_innen in meiner Wohnung standen, hatte ich mir selbst zu verdanken. Als WM-Medaillengewinnerin musste ich täglich ein Zeitfenster von 90 Minuten angeben, während dem man mich an einem bestimmten Ort für eine Urinprobe auffinden konnte. Und weil auch Sportlerinnen nicht immer im Detail wissen, wo sie wann sind, machte ich es so wie die meisten: Der Einfachheit halber bestellte ich die Inspekteur_innen frühmorgens zu mir nach Hause.
Als ich die «Whereabouts» so eingerichtet hatte, rechnete ich allerdings nicht mit den Schwierigkeiten, die an jenem Morgen eintraten. Ich musste feststellen, dass ich vor dem Zubettgehen zwar nicht zu wenig Flüssigkeit zu mir genommen hatte. Aber wohl die falsche: Bei diversen begleiteten Toilettengängen lernte ich, dass die harntreibende Wirkung von Prosecco kurzfristiger Natur ist. Es war eingetreten, was ich an diesem Morgen – dem einzigen im Jahr, an dem man mich zu Hause zur Dopingkontrolle bat – am wenigsten brauchen konnte: Die totale Dehydrierung.
Und so sass ich mit Kopfschmerzen am Küchentisch, vor mir ein grosser Krug Tee, gegenüber drei gesprächige Sportfans, die nebenberuflich für Antidoping Sportler_innen kontrollieren. Drei! Eigentlich kam jeweils nur eine Person zum Überraschungsbesuch. Aber an diesem Tag waren zwei Lernende dabei, die nun auch auf ein Lebenszeichen meiner Blase warteten. Normalerweise, soviel wussten sie bereits, dauere die Abgabe der Probe nicht länger als eine halbe Stunde.
Wie lange es gehen kann, wenn es nicht normal läuft? Nur so viel: Es war beinahe Mittag, als ich völlig erschöpft und mit einem gluckernden Bauch zurück ins Bett kroch. Das Leben als Sportlerin kann unfassbar ermüdend sein!
Plan B

Doppelbürger
Von Bruno Ziauddin
Zum besseren Verständnis meiner Lage zunächst folgende Information: Ich bin der Sohn eines Südinders und einer Schweizerin, habe eine französische Grossmutter, wurde in Ghana gezeugt und besitze den britischen sowie den Schweizer Pass.
Heute mag das nichts Aussergewöhnliches mehr sein. Anfang der Siebzigerjahre des letzten Jahrhunderts empfand man sowas jedoch als ziemliches Chrüsimüsi. «Man» sowieso, aber auch ich selbst. Umso identitätsstiftender war es zu wissen: Ich bin ein in Zürich geborener Zürcher, und Zürich ist das Beste, was die Schweiz und nach damaligem Kenntnisstand die Welt zu bieten haben, und der Zürcher Schlittschuhclub, dem ich von Rang 3 des Hallenstadions durch den Zigaretten-, Zigarren- und später Cannabisnebel hindurch meine unverbrüchliche Unterstützung aufs Eis hinab schrie, dieser ZSC ist der beste Eishockeyverein der Schweiz und der Welt sowieso, und in der wichtigeren, da selbst betriebenen Sportart Fussball existieren zwei Vereine: Zum einen meine Young Fellows Zürich, damals Liftverein zwischen 1. Liga und Nationalliga B, bei den Junioren aber Top of the Pops. Zum anderen, nein, ganz bestimmt nicht die Grasshoppers, schliesslich wohnten wir in einer kleinwüchsigen Appartementwohnung, wo ich bis zum verdammten zwölften Lebensjahr das Zimmer mit den Eltern zu teilen hatte, während GC der Klub aller Vorgesetzten, Segelbootbesitzer und sonstigen Golfspieler war. Jenes GC auch, das an einem Uefa-Cup-Match, woran ich einfach nicht aufhören zu denken konnte, von englischen Fans auf ebenso effiziente wie infantile Weise verhöhnt worden war, indem nämlich diese Fans auf einem Transparent den Namen «Grasshoppers» in einer um die beiden ersten Buchstaben gekürzten Fassung wiedergaben.
Nein, natürlich nicht GC, sondern FCZ. Karli Grob, Köbi Kuhn, Peter Risi, Illja Katic, René Bo!-Bo!-Botteron! Doppel-Cöp-Sieger 1972 und 1973.
Dann trat Mäse in mein Leben.
Mäse war eines Tages in unser Mietshaus gezügelt. Weil seine Familie zwei Appartements bezog, brauchte er das Zimmer nicht mit den Eltern zu teilen, sondern nur mit seinem Bruder, was er als mindestens so störend empfand. Mäse war mehr als drei Jahre älter als ich – ein halbes Leben. Er wurde mein allerbester Freund. Um sich in meiner Gegenwart nicht allzu sehr zu langweilen, brachte er mir das Nötigste bei: Schuhe binden, Quartett spielen, ergo Zahlen bis 10’000 lesen (3750 U/Min; Hubraum: 1699cm3), Federball, Tischtennis, Aussenristpässe.
Cöp-Sieger?, höhnte Mäse. Wir sind Meister! Das ist das einzige, das zählt.
Aber wir haben Köbi Kuhn.
Mäse: Das ist der zweitbeste Fussballer der Schweiz. Wir haben den besten!
Unser Goalie…
…ist eine Pumpi. Wir haben den Nationalgoalie!
Mäse war Fan des FC Basel. Das war die Mannschaft, die, soweit ich zurückdenken konnte – also mindestens zwei Jahre –, immer und immer Meister wurde. Und im Europacöp durch ehrenvolle Niederlagen glänzte, die ehrenvoller kein anderes Schweizer Klubteam hinbekam.
Mäse war, wie gesagt, mehr als drei Jahre älter als ich. Er war, nach meinen Eltern und vor meinen Grosseltern, der wichtigste Mensch im meinem Leben. Dennoch widerstand ich während vieler Wochen und Monate seinen Frotzeleien und Attacken auf meinen FCZ. Bis wir eines Tages zusammen in den Letzigrund gingen, Zürich gegen Basel, Kuhn gegen Odermatt. An das Resultat kann ich mich nicht erinnern, nur daran, dass Basel wieder einmal gewann. Und natürlich an den Satz, den ich nach dem Schlusspfiff zu Mäse sagte: «Du, ich werde glaub auch langsam Basel-Fan.»
Die nächsten plusminus vierzig Jahre sind rasch erzählt: Ich hielt dem FCB die Treue – Absturz in die Nationalliga B hin, grüne Trams und spezieller Dialekt her. Identitätstechnisch eröffneten sich dadurch weitere reizvolle Konstellationen: Ein undefinierbar unschweizerisch aussehender Bub, der eindeutig definierbares Zürichdeutsch spricht und mit rotblauem Trikot in der Muttenzer Kurve steht?
Den Basel-Fans gefiel das – es gab also in dieser an einer Flussattrappe namens Limmat gelegenen Bankierssiedlung Menschen mit Verstand und Geschmack. Mir wiederum gefiel, dass die Basler den Fussball ernster zu nehmen schienen als die Zürcher, ihn zugleich mit mehr Humor und Esprit kommentierten, was damit zusammenhing, so legte ich es mir später zurecht, dass sich in Basel auch Lehrer und Intellektuelle für Fussball begeisterten, während dasselbe Milieu in Zürich die Sportart für den Hundehaufen der Freizeitgestaltung hielt.
Wenn ich nach Basel an ein Spiel fuhr, passte ich mich an, darin hatte ich als Sohn eines Dunkelhäutigen ja Übung. Am Wurststand bestellte ich einen «Chlöpfer», auch wenn ich nie ganz verstand, warum die Baslerinnen und Basler einem kommunen Cervelat nicht einfach Cervelat sagen konnten.
Aus heutiger Sicht könnte man meinen: Der hat das schlau gemacht – ein wenig so wie jene, die in den Achtzigerjahren Microsoft-Aktien gekauft haben –, sein Verein wird immer Meister, und international muss er sich nicht schämen wie sonst eigentlich jeder andere Fan jedes anderen Schweizer Vereins.
Aus damaliger Sicht gilt es allerdings festzuhalten, dass ich, um es Sportdeutsch zu formulieren, den richtigen Zeitpunkt für meinen Rücktritt als FCZ-Fan verpasst hatte. Zwar wurden wir – und mit «wir» ist jetzt der FCB gemeint – noch zweimal Meister. Ich war beide Male dabei: 1977 beim Entscheidungsspiel gegen Servette vor 50’000 Zuschauern im Wankdorf. Und 1980 beim 4:2 gegen den FCZ im Letzigrund. Nach dem Spiel lief ich mit den Baslern triumphierend Richtung Bahnhof, obwohl mein Heimweg in umgekehrter Richtung lag.
Ansonsten fiel mein Vereinswechsel ausgerechnet in jene Phase, in der der FC Zürich dreimal hintereinander die Meisterschaft gewann. Danach war während gefühlten Jahrzehnten der Segelbootbesitzerclub dran. Kam hinzu, dass ich mich auch ungeachtet der jeweiligen Resultat- und Tabellenlage immer mal wieder fremd im eigenen Fankörper vorkam, denn eben: Zwar wusste ich nicht so recht, zu wie vielen Prozent ich mich als Schweizer, Inder, Franzose oder Brite zu fühlen hatte, aber Hundertprozent Züri: Das stand fest.
Und dann gab es natürlich die Momente, in denen mir meine Zürcher Umgebung die Vereinsfahnenflucht heimzahlte. Mit unübertroffener Vehemenz an dem Abend, als einem im Dienste des FCZ stehenden Rumänen mit der Aura eines Rausschmeissers in letzter Sekunde der Ball vor die ansonsten eher ungeschickten Füsse fiel, woraufhin sein Verein statt meiner Schweizer Meister wurde.
Weil ich zu Renitenz und Insubordination neige, bestärkten mich solche Erlebnisse in meiner unverbrüchlichen Zuneigung zum FCB. Trotzdem wäre es für einen in Zürich geborener Zürcher oft einfacher gewesen, dem FC Zürich die Daumen zu drücken oder, nach einem Gewinn bei den Euro Millions, allenfalls den Grasshoppers. Aber im Leben geht es bekanntlich nicht darum, immer nur das zu tun, was die anderen machen.
Hier schreiben abwechselnd Bruno Ziauddin, Benno Maggi, Bänz Friedli und Benjamin Steffen.


